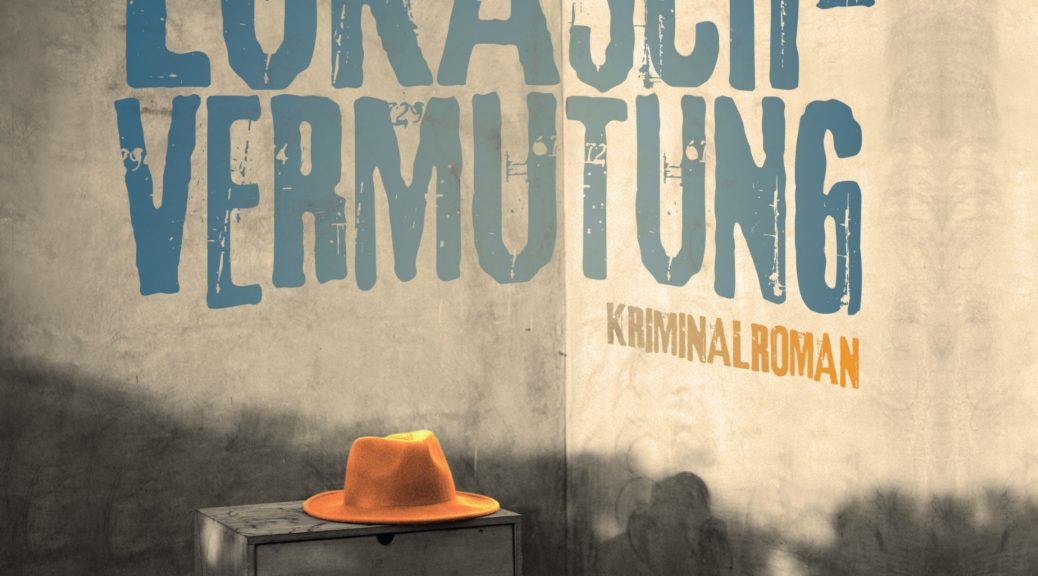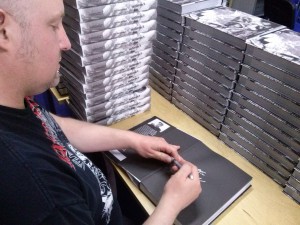Im Hirnkost Verlag gibt es 3 Neuerscheinungen, die sowohl online, als auch in unserem Laden in der Hertzbergstr. erworben werden können.
Zudem sind alle drei Bücher auch als epubs und pdfs für den eReader erhätlich.
1. Swing ist wieder angesagt. Zeit, die Wurzeln dieser Jugendkultur zu entdecken, die eigentlich nur ihren Spaß haben wollte und erst durch die Verfolgung durch die Nazis zur politisch-subversiven Untergrundbewegung wurde.
 Zum Inhalt:
Zum Inhalt:
Die Leidenschaft der „Swing Kids“ für die „Negermusik“ Jazz und englische Kleidung, ihr Tanzstil und ihr aufmüpfiger Individualismus genügten den Nazis, um massiv gegen sie vorzugehen: Hunderte von Jugendlichen wurden wegen „Anglophilie“ in „Schutzhaft“ genommen, zumeist ohne offizielle Anklage oder Verhandlung, viele landeten im KZ.
Jörg Ueberall begab sich in Hamburg auf die Spuren der ersten städtischen Jugendsubkultur, die ihr Selbstverständnis aus der Musik zog. Er zeichnet die Entwicklung der Swing Kids von ihrer Entstehung 1936 bis zu ihrem (Nicht-)Ende 1943 – 1945 nach und erforschte, was aus den Opfern und Tätern wurde – bis heute.
Shop online.
2. Welcher Titel könnte besser in die Weihnachtszeit passen als diese O-Ton-Sammlung und Analyse zum Verhältnis Jugend & Konsum.
 Zum Inhalt:
Zum Inhalt:
„Hol ich mir!“ – so heißt ein häufig aus dem Munde von Jugendlichen zu vernehmender Satz. Gemeint ist dann zumeist das „megageilste“ Handy, die supercoole Jacke oder ein anderes „Must-Have“ …
Bemerkenswert dabei ist, dass in dieser Formulierung von „kaufen“ gar nicht die Rede ist: Warum eigentlich nicht? Ist Geld ein Tabu-Thema unter jungen Leuten? Hat man es einfach, ohne darüber sprechen zu müssen? Ist man sich vielleicht über den Wert des Geldes nicht im Klaren? Sieht man die Arbeit gar nicht, die es gekostet hat, die „Kohle“ zu erwerben?
Welche Bedeutung hat das Geldhaben und Geldausgeben für Jugendliche? Was für einen Stellenwert besitzen Konsumartikel innerhalb von Jugendkulturen? Inwieweit kann man sich in sie einkaufen? Angesagte Markenkleidung zu tragen, sich cool zu stylen, über neueste Informationstechnik zu verfügen – wieweit verschafft das Zugehörigkeit und Anerkennung?
Ersaufen die jungen Leute von heute im Konsumrausch? Riskieren sie leichtfertig, in Verschuldungsspiralen zu geraten? Kommt vielleicht sogar das dabei zu kurz, was wirklich wichtig ist im Leben? Zählt mehr Haben als Sein? Oder leben junge Menschen längst auch Alternativen und stehen hinter Fragen wie diesen nur die üblichen Besorgnisse älterer Menschen und das Lamento von missgünstigen Pädagog_innen?
In diesem Buch kommen zu diesen Fragen echte Expert_innen zu Wort: junge Leute selbst.
Der zweite Band der Hirnkostreihe beschäftigt sich mit dem Thema Deutschrock.
Shop online.
3. Der neue Band in der Hirnkostreihe beschäftigt sich mit Deutschrock.
 Zum Inhalt:
Zum Inhalt:
„Deutschrock“ boomt wie kein zweites Genre im Rock- und Pop-Business. Deutschrock-Fans findet man inzwischen auf jedem Schulhof. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter diesem „Label“? Mit Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg oder Marius Müller-Westernhagen hat die aktuelle „Deutschrock“-Generation nur noch wenig gemein. Hier geben Bands wie die Toten Hosen oder Böhsen Onkelz den Ton an. Für welche Inhalte steht diese Szene? Wie grenzen sich die Bands und ihre Fans von den Rechtsrockern ab? Deutschrock – was ist das eigentlich? Hier kommen die zu Wort, die es wissen mu?ssen: 118 Musiker aus 55 Bands.
Shop online.